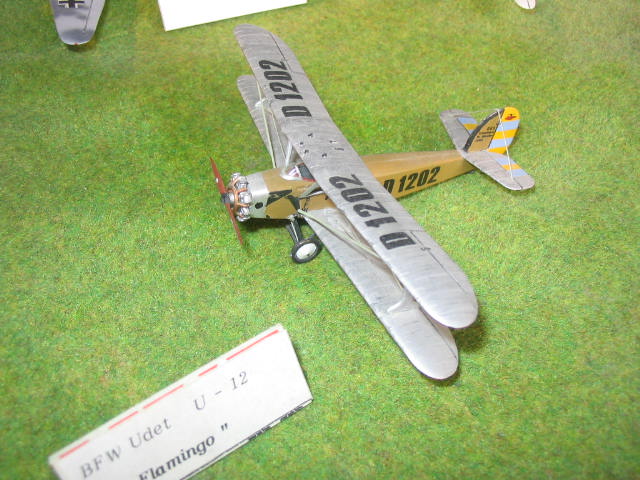Die Klemm L25 war ein zweisitziges Sportflugzeug in Leichtbauweise von Hanns Klemm und Robert Lusser aus dem Jahr 1928. Sie war die erste eigene Flugzeugentwicklung unter dem Namen der Leichtflugzeugbau Klemm GmbH, nachdem diese aus der Flugzeugbauabteilung der Daimler-Motoren-Gesellschaft hervorgegangen war. Die Werksbezeichnung L25 wurde 1930 mit der Einführung der RLM-Bezeichnungen offiziell in Kl 25 geändert. Die Bezeichnung „L25“ wurde aber auch nach 1930 vielfach beibehalten.

Nach Gründung der Leichtflugzeugbau Klemm GmbH nahm Hanns Klemm 1927
in seinem neuen Betrieb zunächst die Serienfertigung der noch bei der
Daimler-Motoren-Gesellschaft entwickelten Daimler L20
auf. Gleichzeitig beauftragte Klemm seinen Konstrukteur Robert Lusser
mit der Entwicklung eines eigenen, an die Daimler L20 angelehnten
Klemm-Entwurfs unter der Bezeichnung Klemm L25. Wie bei der Daimler L20
stand für Hanns Klemm beim Entwurf der Klemm L25 die Idee eines kleinen,
schwachmotorisierten, kostengünstigen Volksflugzeugs im Mittelpunkt.
Jedoch zeigte sich bei der Vermarktung der Daimler L20, dass viele
Kaufinteressenten an einer leistungsstärkeren Variante des Flugzeugs
interessiert waren. Auch Robert Lusser favorisierte eine
leistungsstärkere Auslegung der Daimler L20 als konkurrenzfähiges
Wettbewerbsflugzeug, die auch kunstflugtauglich sein sollte. Neben dem
20 PS starken Daimler-F7502-Motor der Daimler L20 sah Lusser daher für die Klemm L25 auch den 50 PS starken Salmson-AD9-Motor
aus Frankreich als Antrieb vor. Obwohl sich die Daimler L20 und die
frühen Varianten der Klemm L25 äußerlich sehr stark ähneln, entstand
durch den optionalen, stärkeren Motor eine weitgehende Neukonstruktion.
Der Prototyp der Klemm L25 (WNr. 65, D-1357) entstand bereits
Anfang 1928 im ehemaligen Daimler-Flugzeugwerk in Sindelfingen. Der
Erstflug erfolgte mit Daimler F7502 als Klemm L25 vermutlich im April 1928. Als Klemm L25I
wurde die Maschine im gleichen Monat erstmals mit dem Salmson-Motor
geflogen. Werksseitig wurde die Klemm L25 ab Juni 1928 ausschließlich in
diesen beiden Motorisierungsvarianten ausgeliefert, wobei Einzelstücke
bei ihren Betreibern auch auf andere Motore umgerüstet wurden. Im Juni
1928 fand in Bodnam auf dem Bodensee die Erprobung des Prototyps auf
Schwimmpontons als Klemm WL25 statt. Im gleichen Monat erfolgte die Serienumstellung von der Daimler L20 auf die Klemm L25.
Da der leistungsstärkere Salmson-Motor optional auch eine höhere
Zuladung gestattete, entstand im Herbst 1928 eine vergrößerte Variante
der L25 unter der Bezeichnung Klemm VL25. Sie war rumpfseitig im
Bereich des vorderen Cockpitsitz um etwa 20 cm verbreitert und
ermöglichte die Aufnahme von zwei Passagieren auf der vorderen Sitzbank.
Diese Variante kam in erster Linie bei kleinen Zubringer- und
Rundflugdiensten zum Einsatz.
Für den amerikanischen und japanischen Markt erwarb Inglis Uppercu 1928 die Lizenzrechte zur Weiterentwicklung und zum Nachbau der Klemm L25 in den USA. Hierfür gründete er die Aeromarine-Klemm Corporation
in Keyport, NJ. Uppercu ließ die Konstruktion auf amerikanische
Maßeinheiten und Verbindungselemente abändern. Die Serienfertigung der Aeromarine-Klemm AKL25
mit Salmson AD9 wurde noch 1928 aufgenommen. Der amerikanische Markt
zeigte allerdings wenig Interesse an der schwach motorisierten
Holzkonstruktion. Uppercu ließ daraufhin einige AKL25 mit dem
amerikanischen 85 PS starken Le-Bond-Motor als AKL25B ausstatten. Einige Exemplare wurden nach Kanada und Argentinien verkauft. Die Weltwirtschaftskrise 1929 führte zur Insolvenz der Aeromarine-Klemm Corporation. Die Produktion wurde nach knapp 50 AKL25 eingestellt.
Beim Europarundflug 1929
zeigte sich die fortgeschrittene Leichtflugzeugbautechnik der
englischen und italienischen Konkurrenz, aber auch deutscher
Konkurrenten wie etwa Messerschmitt gegenüber der konventionellen Klemm
L25. Robert Lusser entwarf daher für den folgenden Rundflug 1930
eine spezielle Wettbewerbsvariante der Klemm L25 mit kürzerem Flügel,
verbesserter Aerodynamik und neuem Leitwerk. Außerdem erhielt das
Flugzeug eine Kabinenhaube. Der Salmson-AD9-Motor wurde durch den
doppelt so starken 80-PS-Argus-As-8-Motor ersetzt. Unter der Bezeichnung
Klemm L25E
(nicht zu verwechseln mit der späteren Klemm-L25e-Serienmaschine)
wurden vier Maschinen für den Europarundflug fertiggestellt, von denen
zwei Maschinen Platz 2 und 3 behaupten konnten. Ein Serienbau des
Lusserschen Wettbewerbsmodells fand allerdings nicht statt, da Hanns
Klemm die Klemm L25 auch weiterhin als Einstiegsmodell im unteren
Sportflugzeugsegment erhalten wollte.
Stattdessen überarbeitete Robert Lusser im Winter 1930/31 den
Klemm-L25-Basisentwurf und übernahm hierbei auch einige
Konstruktionsmerkmale des Wettbewerbsflugzeugs. Bei der Klemm L25b
wurden Rumpf und Tragflächen strukturell geringfügig zur
Gewichtsreduzierung überarbeitet, lediglich das Leitwerk wurde
grundlegend neu gestaltet. Mit der Einführung der L25b erhielten die
frühen L25 vor 1931 die Bezeichnung Klemm L25a. Die Motorisierung blieb
unverändert beim Daimler F7502 in der Klemm L25b bzw. beim Salmson AD9
in der Klemm L25bI.
Formal übernahm das Heereswaffenamt im Reichswehrministerium
1930 die Vergabe von Typenbezeichnungen für Flugzeuge, die bei der
Reichswehr zum Einsatz kommen sollten. Für Klemm-Flugzeuge sah das
Heereswaffenamt die Bezeichnung „KL“ vor. Die offizielle Bezeichnung der
bisherigen Klemm L25 lautete daher ab 1930 Klemm KL25.
Für den Deutschlandflug 1931 entstand auf besondere Anforderung von Wolf Hirth die Sonderanfertigung einer Klemm L25b mit einem 60 PS starken Hirth-HM-60-Motor seines Bruders Hellmuth Hirth.
Um die niedrigste Gewichtsklasse des Wettbewerbs trotz des schwereren
Motors beizubehalten, ließ Hanns Klemm die Struktur der L25b für diese
Sonderanfertigung nochmals gewichtsmäßig überarbeiten. Beim
Deutschlandflug konnte Hirth mit der einzigen L25bfVII das Luftrennen
über 2150 km als Zweiter hinter Oskar Dinort auf einer
leistungsstärkeren Klemm L26 beenden.
Nachdem Wolf Hirth die Vorzüge des leichten, aber kostengünstigen
und zuverlässigen Hirth-Motors für das Leichtflugzeug-Konzept von Hanns
Klemm demonstriert hatte, übernahmen Klemm und Lusser diesen Motor als
künftigen Standardmotor für das Klemm L25 Leichtflugzeug. Lusser
überarbeitete den Entwurf der Sonderanfertigung L25bfVII einerseits zur
weiteren Gewichtseinsparung, andererseits um mit der Struktur höhere
Belastungen infolge des stärkeren Motors aufnehmen zu können. Die Klemm L25c
ging 1931 mit einem 72 PS starken Hirth-HM60-Motor in Serie und
beendete die Epoche der 20-PS- und 40-PS-Daimler/Salmson-Motore. An der
Klemm L25c war auch der britische Klemm-Vertrieb unter Edward Stephen
interessiert, da diese Konstruktion grundsätzlich auch für die Aufnahme
schwererer englischer Motore geeignet war, die seine Kunden gegenüber
deutschen und französischen Motoren präferierten. Stephen gründete in
England die British Klemm Aeroplane Company
und erwarb von der Leichtflugzeugbau Klemm GmbH die Lizenzrechte an der
Klemm L25c. Stephen ließ die Maschine auf englische Bedürfnisse
umkonstruieren und mit einem englischen Pobjoy-Niagara-Motor ausrüsten. In England entstanden bis 1938 insgesamt 135 British Klemm L25C1 Swallow im Lizenzbau nach dem Vorbild der Klemm L25c.
Nach Abschluss der L25c-Entwicklung verließ Robert Lusser 1932
die Klemm-Werke. Die weitere Entwicklung der Klemm L25 übernahm ab 1933
sein Nachfolger Friedrich Fecher. Er widmete sich zunächst der Ausrüstung des Flugzeugs, das im Entwurf der Klemm L25d
erstmals mit Niederdruckreifen und Bremsen ausgestattet wurde. Die
Struktur der L25d wurde soweit verstärkt, dass die bestehenden
Zulassungsbeschränkungen der L25 für den Kunstflug aufgehoben werden
konnten. Der 72-PS-Hirth-HM60 blieb bei der Klemm L25dVII zunächst als
Standardmotor erhalten. Er wurde allerdings bereits kurz nach Anlaufen
der Serie auf den 80 PS starken, verbesserten Hirth HM60R bei der Klemm
L25dVIIR geändert. Die verbesserte Klemm L25d wurde 1933 vom Deutschen Luftsportverband
(DLV) als Standardflugzeug für die deutschen Luftsportvereine
festgelegt. Mit etwa 270 Flugzeugen wurde die Klemm L25d zur
meistgebauten L25-Variante. Nach der Ablösung der L25 durch die Klemm Kl 35 beim DLV wurde die Klemm L25d ab 1936 für den Exportbedarf weitergebaut. Die Serienfertigung der L25d endete erst 1940/41.
Die letzte Variante Klemm L25e (nicht zu verwechseln mit dem
Wettbewerbsflugzeug L25E von 1929) entstand 1934. Fecher führte für
diese Variante eine grundlegende aerodynamische Überarbeitung von Rumpf,
Flügel und Leitwerk durch. Die L25e weist dadurch deutlich runde Formen
und einen Elipsenflügel auf. Antriebsseitig blieb der Hirth HM60R Motor
in der Klemm L25eVIIR als Standard erhalten. Die Klemm L25e war die
letzte Entwicklungsstufe einer mehr als 10-jährigen Flugzeugentwicklung.
Bereits während ihrer Entwicklung legte das Reichsluftfahrtministerium
das Anforderungsprofil für ein neues Standard-Schulflugzeug vor, das
neben gutem Trainingsflugverhalten vor allen Dingen einfach und
kostengünstig und schnell in großen Mengen gebaut werden sollte. Da sich
die L25e im Serienbau als aufwendig erwiesen hatte, sah Fecher von
einer Weiterentwicklung zur Klemm L25f ab und entschied sich für eine
vollständige Neuentwicklung unter der Bezeichnung Klemm Kl35.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Klemm_Kl_25
Videos: Klemm L 25
Wunder des Fliegens - Der Film eines deutschen Fliegers